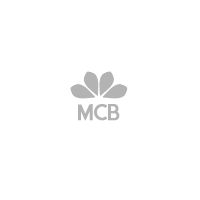Introduction
Qu'est-ce qui conduit à l'étude de l'histoire germano-juive ?

Au printemps 1911, l'entrepreneur de Kassel Albert Gotthelft et son épouse Mathilde ont commandé un portrait de leur fille Julie. Ils en ont confié l'exécution à un peintre qui était l'un des portraitistes les plus recherchés de son temps. Le tableau, créé dans les mois qui suivaient, fait maintenant partie d’une œuvre tardive et est une propriété privée. Il montre une jeune femme assise à une fenêtre ouverte, le dos appuyé contre le cadre. Elle est de silhouette élancée, la robe verte de coupe simple. Un petit collier de pierres rouge foncé et un fin bracelet en or à son poignet sont les modestes bijoux qui soulignent sa beauté : Le teint lisse, les yeux marron foncé, les cheveux pleins tenus par un ruban. Songeuse, elle regarde le spectateur hors de l'image. Dans les doigts de sa main gauche, elle tient une rose. Le rouge vif des pétales se détache nettement de la couleur verte de sa robe et des arbres derrière sa fenêtre, correspondant au rouge vif de ses joues et de ses lèvres. Le portrait était un cadeau de ses parents pour son 16e anniversaire en août 1911. Pour le peintre, que devait symboliser cette rose ? Pour le bonheur que la fille d'une bonne famille aurait dû avoir plus tard dans la vie ?
Le tableau était accroché dans le salon de l'appartement des parents dans la Spohrstraße. Quand un visiteur est entré dans la pièce, il a d’abord aperçu la jeune femme aux yeux pensifs. Le tableau évoquait la fierté du couple pour leur fille - et il faisait allusion à la réussite économique des Gotthelft et de leur position sociale dans la ville. Pour ceux qui ne pouvaient pas lire le coup de pinceau du peintre, sa signature dans le coin inférieur droit leur disait qu'un Gotthelft pouvait aussi commander des œuvres à des artistes qui travaillaient pour la maison impériale allemande et la noblesse prussienne.
Les Gotthelfts avaient acquis leur prospérité grâce à un travail acharné, des efforts inlassable et de avisées décisions, leur notoriété grâce à un grand esprit civique et public : ils s'impliquaient dans des associations et des organismes publics, et faisaient des dons à des fins sociales, culturelles et patriotiques. Dans l'enfance de Julie, Adolph Gotthelft, dont le frère Carl avait fondé la société, était toujours à la tête de la famille.
Après la mort précoce de Carl,
Adolph et sa femme Fanny étaient le centre des Gotthelfts, qui se réunissaient dans la villa du couple le dimanche et les jours fériés. Dans les mémoires de leur fils Richard, on trouve une déscription de l’ambiance familiale vivante de ces réunions hébdomadaires :
« Le dimanche soir, tous les enfants et les petits-enfants étaient réunis là, et la table de la grande salle à manger s'est agrandie au fur et à mesure que la famille s'est agrandie. Comme ces soirées étaient belles et avec quelle joie nous avons été traités ici ! Une étrange magie a créé une atmosphère familiale et les heures que nous avons pu passer là-bas se sont envolées en un éclair. Et quand l'heure avancée nous a rappelé de marcher, il était encore trop tôt pour la mère, et elle a magistralement réussi à nous faire gagner au moins un autre quart d'heure. En ces dimanches soirs, les amis des enfants et des petits-enfants étaient souvent les invités de la villa. »
Richard Gotthelft, Erinnerungen aus guter alter Zeit (Mémoires du bon vieux temps), Kassel 1922, p. 36.
Parmi les invités d'Adolph et Fanny se trouvaient les fils de Carl, Wilhelm, Theodor et Albert avec leurs familles. À la table du dîner, Julie, qui avait alors six ou sept ans, était assise à côté de ses cousins, qui étaient à peu près du même âge. Selon le grand-père, les épais cheveux noirs des filles étaient un héritage de l'arrière-petite-fille Thérèse, qui les avait apportés de Dresde à Kassel en les mariant dans la famille. Les filles se tenaient bien droites comme un dé à table, mangeaient et buvaient selon les règles que les enfants devaient respecter faire, ou, après le repas, posaient les mains sur les genoux. Ils entendaient parler de la tante aux cheveux noirs, qui était aussi la leur, et des repères familiaux que le grand-père leur rappelait sans cesse : une fois, deux fois, trois fois, quatre fois... Il était soutenu par Richard, qui a soigneusement corrigé là où la mémoire de son père manquait, ou ajoutait à ce qu'il avait oublié. Adolph Gotthelft était un narrateur facile à écouter, presque un acteur qui se glissait dans les différents personnages en imitant leurs voix, leurs gestes et leurs mimiques.
Attentive, avec de gros yeux et et les oreilles dressée, Julie suivait les histoires. Le peu que son esprit enfantin pouvait saisir était imprimé dans ses images : la vieille maison aux sols en pente ; les soldats en uniformes multicolores qui emportaient des livres et des feuilles de papier imprimées ; les enfants réunis autour d'une table, juste de leur âge, buvant de l'eau car leurs parents n'avaient pas d'argent pour le lait ; l'homme qui en jurant essayait de tirer ses bottes de la boue ; le petit garçon qui court dans la rue en criant le mot « victoire »
encore et encore avec enthousiasme ; la machine, si grande qu'elle ne passait pas sous un porche ; enfin le lourd blason que les artisans avaient placé comme clé de voûte dans l’arc du portail. C'était pour eux l'image la plus féerique de toutes, car en racontant l'épisode, le grand-père utilisait toujours le mot « royal »
.
Lorsqu'elle grandit, le grand-père était déjà mort. A sa place, son fils Richard a répondait aux questions sur ce qui n'avait pas ou peu été compris auparavant. Le contenu et le contexte des images ont furent précisés et complétés par d'autres épisodes que le grand-père avait rapportés mais qui lui étaient sortis de l'esprit. Comme un puzzle qui s'assemble pièce par pièce, l'histoire de sa famille, les Gotthelfts, a été complétée lors des sessions de causettes avec son oncle Richard. Les lacunes qui furentont été comblées par les mémoires que Richard a publiées beaucoup plus tard - en 1922, l'année de son mariage - « uniquement pour les enfants, petits-enfants et autres descendants, pas pour des personnes étrangères »
(Mémoires,
p. 3). Elle a gardé le volume étroit, qui n'avait été publié qu'en petite édition, comme un trésor, en le lisant régulièrement, surtout pendant les mauvaises années.
Richard Gotthelft, Erinnerungen aus guter alter Zeit
(Mémoires du bon vieux temps).
1841 gründete ihr Großonkel Carl Gotthelft, der das Schriftsetzerhandwerk erlernt hatte, im elterlichen Haus in der Mittelgasse 31 eine Druckerei. Die Worten "elterliches Haus"
und "Druckerei",
die sie in ihren Kinder- und Jugendtagen so oft gehört hatte, beschrieben den Sachverhalt zutreffend, doch machten sie den Anfang größer, als erwar: In dem alten Haus bewohnten Carls Eltern im ersten Stockwerk
„zwei schmale, kleine Zimmer“,
die der Straße zugingen.
„Nach dem Hofe zu lagen zwei Schlafzimmer.“ Die anderen Zimmer auf diesem und den anderen Stockwerken waren vermietet. Das Adressbuch der Stadt Kassel für das Jahr 1857 gibt Auskunft über die damaligen Bewohner: Ganz oben, unter dem Dach, hauste - jeder in einer winzigen Kammer - die Kleinhändlerin Meyer und der Bürodiener Kaiser, in der Etage darunter wohnte der Maschinist Hammerschlag und der Küfermeister Braun mit seiner Familie. Ein Stockwerk tiefer lagen die Räume der Eltern und die des Schuhmachermeisters Mösta – und im Erdgeschoss schließlich befand sich, in zwei nicht zu großen Zimmern, die Druckerei. Auf allen Stockwerken ging der
"Fußboden in den vorderen Räumen
[...]
sozusagen bergab, so baufällig war das Haus" (Gotthelft,
Erinnerungen, S. 10).
Das Inventar der Druckerei bestand aus nur einer hölzernen Handpresse, die Carl zusammen mit einigen Schriftsätzen gebraucht erworben hatte, das Personal aus ihm selbst und einem Gehilfen, der ihn bei der Bedienung der Maschine unterstützte. In der ersten Zeit verhalfen vor allem Freunde, Bekannte und Verwandte mit Aufträgen und eifriger Mundpropaganda der kleinen Unternehmung zu Einnahmen. Als Adolph, den sein älterer Bruder im Schriftsetzerhandwerk ausgebildet hatte, von seinen Gesellen-Wanderjahren zurückkehrte und in die Firma eintrat, musste die zwei Familien ernähren.
Richards beschreibt in seinem Rückblick anrührend, wie bescheiden Carl und Adolph mit ihren Familien viele Jahre in beengten Verhältnissen lebten. Äußerste Sparsamkeit bei Kleidung und Ernährung galt als oberstes Gebot, "nur das zum Leben unbedingt Notwendige
[durfte] angeschafft und verbraucht werden", statt Milch wurde Wasser getrunken, Kleider durch Um- und Annähen von Abgetragenem hergestellt oder ausgebessert, die wenigen Zimmer zugleich als Wohn- und Schlafräume genutzt. Um die Ausgaben gering zu halten, halfen die Ehefrauen, Kinder und Verwandte "in der Firma"
mit, falzten die bedruckten Bögen, kuvertierten sie, bestrichen die Matrizen mit frischer/neuer Farbe. Die Arbeitstage Brüder und ihrer Frauen begannen früh um sechs und dauerten bis in die späten Abendstunden. Es waren karge Jahre, in denen nichts vorwärts ging, die Geschäfte stagnierten.
1853 endlich gelang dem Großvater und dem Großonkel der entscheidende Schritt auf ihrem Weg zum Erfolg. Am 4. November erschien das Gewerbliche Tageblatt und Anzeiger für Kassel und die Umgebung
als Probenummer in einer Auflagenhöhe von 150 Exemplaren, hergestellt auf der hölzernen Handpresse, die 13 Jahren nach der Gründung des Unternehmens noch immer die einzige Maschine in der Druckerei war. Ganze vier Seiten zählte die Probenummer, gedruckt auf zwei Bögen/Bogen Papier. Im November unternahm Adolph von Kassel
aus "Streifzüge in die Umgegend und klapperte trotz des kalten Winterwetters die umliegenden Städtchen und Flecken ab", um so Abonnenten für die junge Zeitung zu gewinnen. Mit einigen Exemplaren der Probenummer im Rucksack ging es zu Fuß oder auf einem Fuhrwerk, das dieselbe Richtung nahm/hatte, nach Fritzlar, Grebenstein, Felsberg, Melsungen, Großalmerode und Ziegenhain. Die beschwerlichen Reisen führten über verschlammte Wege. Einmal blieb der Großvater stecken, nachdem er vom Fuhrwerk herabgestiegen war. Dieses Detail bildete den Höhepunkt der Erzählung an der sonntäglichen Tafel: Gegen jede Etikette erhob der Großvater sich von seinem Stuhl und ahmte mit ausdrucksstarken Bewegungen nach, wie er die Stiefel, um sie nicht zu verlieren, am Schaft festhielt, während er seine Beine aus dem klebrigen Schlamm in die Höhe zog.
Der Zeitungkopf der Nummer 1 vom 5. Dezember 1853 (Mikrofilmkopie).
Am 5.12.1853 brachten die Brüder die erste Ausgabe der Zeitung in 400 Exemplaren heraus. So begann der Aufstieg. Die Namen der ersten Abonnenten, die ihm ihr gutes Geld auf seinen Werbereisen durch Schlamm und Schnee im Voraus anvertrauten, für den Bezug einer Zeitung, die nach wenigen Ausgaben eingehen konnte, erwähnte Adolph Gotthelft in seinen Erzählungen noch fünf Jahrzehnte später mit dankbarer Hochachtung. Zu ihnen gehörten in Fritzlar der Landrat Weber, der Postmeister Veith und der Seifensieder Dietrich, in Großalmerode der Bäcker Wilhelm Geyer, in Melsungen der Bahnhofsvorstand Hoffmann, in Münden der Müller Scheede. Sie gratulierten nach ihren Möglichkeiten zum einjährigen, fünfjährigen, zehnjährigen und zwanzigjährigen Bestehen der Zeitung, der sie durch Höhen und Tiefen die Treue hielten, mit einer Karte, einem Brief, einem Strauß, einem Blumengebinde, einem Präsentkorb.
Das Tageblatt
katapultierte die Brüder nicht in ein paar Wochen oder Monaten nach vorne. Langsam ging es aufwärts, in kleinen Schritten, die tagaus und tagein zähe, geduldige und mühevolle Arbeit erforderten. Erst 1869, 16 Jahre nach dem ersten Erscheinen der Zeitung, war das Unternehmen soweit gewachsen, dass "ein großer Setzer- und Maschinensaal, soweit es die räumlichen Verhältnisse gestatten, gebaut, eine Lokomobile und eine Doppelschnellpresse angeschafft und eine Geschäftsstelle sowie ein Redaktionszimmer eingerichtet"
werden konnten (Erinnerungen, S. 63). Es dauerte noch weitere zehn Jahre, bis die Einnahmen es gestatteten, das Geschäft aus der engen Mittelgasse in die breite Kölnischen Straße zu verlegen, dort in ein großes, stattliches und repräsentatives Gebäude mit der Nummer 10. 1879, 38 Jahre nach Gründung der Firma, hatten Carl und Adolph Gotthelft den Sprung in das sogenannte "Zeitungsviertel"
um die Kölnische Straße geschafft, wo auch ihre Mitbewerber mit ihren Unternehmen residierten. Der materielle Erfolg, Voraussetzung für den Umzug, war der Lohn für eine Aufbauarbeit, die fast zwei Generationen in Anspruch genommen hatte.
Seit 1896 prangte über dem Eingangsportal im Mittelbereich der Kölnischen Straße 10 ein mächtiges steinernes Wappen. Es wies den Besucher darauf hin, dass das Unternehmen, das er betrat, für das Hoflager des Kaisers auf der Wilhelmshöhe regelmäßig Druckaufträge ausführte und seine Inhaber sich deshalb "königliche Hofbuchdrucker"
nennen durften. Das Prädikat Königlich
erklärt sich aus den damaligen Machtverhältnissen: der deutsche Kaiser war in Personalunion auch König von Preußen, zu dessen Herrschaftsgebiet Kurhessen und damit auch Kassel seit 1866 gehörten. An dem Morgen, an dem das Wappen von zwei kräftigen Handwerken in den Portalbogen einsetzt wurde, standen Wilhelm, Albert, Theodor und Richard Gotthelft, die das Unternehmen in der Zwischenzeit gemeinsam führten, mit dem alten Adolph Gotthelft auf dem Bürgersteig und betrachten, die Köpfe in den Nacken gelegt, den Fortschritt der Arbeit. Mit verhaltener Stimme bedauerten sie es, dass Carl - der Bruder, der Vater, der Onkel - und seine Frau Therese, die mit ihrem Fleiß in Geschäft und Haushalt, ihrem klugen Wirtschaften und ihrer Fürsorge wesentlichen Anteil am Gelingen des Projekts Gotthelft
hatte, das Ereignis, von dem ganz Kassel sprach, nicht mehr erleben durften. Carl war 1880, ein knappes Jahr nach dem Umzug der Druckerei in die Kölnische Straße verstorben, seine Frau Therese bereits 1869. Über den Männern erhoben sich die vier Stockwerke des Gebäudes, links und rechts von ihnen die Seitenflügel: im Erdgeschoss des linken war die Papier- und Schreibwarenhandlung untergebracht, im Erdgeschoss des rechten die Geschäftsstelle.

Bildtitel
Untertitel hier einfügenButton
Bildtitel
Untertitel hier einfügenButton
Bildtitel
Untertitel hier einfügenButton
Werbung in eigener Sache:
Anzeigen im Casseler Tageblatt and Anzeiger
des Jahres 1888
(Mikrofilmkopien).
Das Gehörte ergänzte sich Julie durch Erfahrenes: Das Durchschreiten des Eingangsportals, das Aufschwingen des Türflügels unter dem Druck der väterlichen Hand. Mit der anderen Hand hielt er die ihre, seit sie die Wohnung im zweiten Stock der Spohrstraße 4 verlassen hatten. Keine zehn Minuten dauerte der Gang: Nach dem Verlassen des Hauses wechselten sie auf den Bürgersteig gegenüber, wandten sich dann nach links und schritten die Straße bis zu ihrer Einmündung in die Kölnische Straße hinab. Sie trippelte mit ihren Kinderschritten an der Seite des Vaters, grüßte artig zurück, wenn er und sie gegrüßt wurden, was sehr oft geschah. An der Kreuzung ging es noch ein paar Meter nach links und schon standen sie vor dem imposanten Gebäude. Es beeindruckte Julie auch, wenn einer der Angestellten, der die große und die kleine Gestalt hatten herannahen sehen, dem Vater zuvorkam und den Türflügel pflichteifrig aufriss und so lange hielt, bis sie an ihm vorbeigeschritten waren. Die Angestellten, die rechterhand an den Schaltern der Annahmestelle zu tun hatten, nickten ihr freundlich zu, deuteten ein Winken an oder reichten ihr eine Süßigkeit, für die sie sich mit einem Knicks bedankte.
Und weiter ging es durch die hinteren Kontore in die Maschinenhallen. Turmhoch, so schien es ihr, wurde sie von den Steindruck-Schnellpressen und den Rotationsmaschinen überragt. Oft trat der Vater mit einer Frage an einen Maschinenführer heran, der daraufhin die schweißnasse Mütze abnahm, was den Vater wiederum veranlasste, ihm begütigend die Hand auf den Oberarm zu legen, um ihm so zu verstehen zu geben, dass seine ehrerbietige Geste doch gar nicht nötig gewesen wäre. Aber sie war es, in der damaligen Zeit, und für beide selbstverständlich.
Das Erzählte, das Gelesen und das Erlebte schufen in Julie ein Bewusstsein für die Leistungen der Vorfahren: der Großväter und Väter und ihrer Ehefrauen. Die Leistungen kamen der Familie zugute
Satz,
den ihre Mutter ihr mit auf den Weg gab, auf den Lebensweg, Inhalt und
Wirkkraft: „Vergiss nie, dass Du eine Gotthelft bist!“e - und der Stadt Kassel und ihren Bürgern. für die Bedeutung der Gotthelfts für die Stadt. hier ein nun die 200 Arbeieter, und für das Ansehen, das ihnen aus dieser Bedueutng zurückfloss und dem seinen guten Klang gab, der Familie den Respekt, den ihr vielen, nicht alle zollten, die Achtung, mit der viele, nicht alle von ihr sprachen.
Was führt zur Beschäftigung mit deutsch-jüdischer Geschichte? Sie hatte, als eine der wenigen Gotthelfts, die Konfession der Väter abgelegt und die lutherische angenommen. Glaubensbeseelt, so schwärmte der Geistliche, der sie auf dem Weg begleitete, habe sie seine Unterweisungen verfolgt. Mit der ihr eigenen Willenskraft, mit der sie in ihrem Leben noch vieles durchsetzte und durchstand, hatte sie den Eltern den Wechsel abgerungen. Dachte der Maler sich die Rose als Symbol für ihre Religiosität? Als sie ihm Modell für die Skizzen saß, aus denen später das Porträt entstand, war sie alt genug, um zu wissen, was der verstorbene Großvater nie erzählt hatte, und sein Sohn, ihr Onkel Richard, in den Plauderstunden nie ergänzte. Alles an der gedrungenen Erscheinung des Malers erweckte Vertrauen: der dunkle Anzug, der ihm etwas Priesterliches verleih, das feine, von einem schlohweißen Backenbart umrahmte Gesicht, die Augen, die freundlich und konzentriert auf sie blickten, während die faltigen Hände ihre Arbeit taten. Sprach sie mit dem älteren Herrn, der langsam und behutsam den Stift über das Papier führte, über die Gedanken, die sie bewegten, beim Wechsel von der mosaischen Religion, so hieß die jüdische damals im Amtsdeutsch, zur protestantischen?
Während der religiösen Unterweisungen hatte sie ihre Gedanken nicht daran verhindern können, sich von den Glaubeninhalten fort- und zu profanerem Dingen hinzubewegen: Damals war die Konfirmation für Protestanten aller Schichten ein Lebensereignis, das neben der religiösen auch gesellschaftliche Bedeutung hatte. Die Konfirmation stand für den Eintritt des Jugendlichen in die Welt der Erwachsenen, in der er Verantwortung für seine Mitmenschen und sich zu übernehmen hatte. Das zeigte sich am sinnreichen Wahlspruch, der dem Konfirmanden als Motto auf seinen weiteren Lebensweg mitgegeben wurden, ebenso an dem Fest, mit dem die Familie - nach ihren finanziellen Möglichkeiten - das wichtige Ereignis bescheiden oder aufwändig feierte. In den besseren Kreisen luden die weiblichen Teilnehmer innerhalb der Konfirmandengruppe zum Kaffeekränzchen bei sich zuhause ein. Wem eine Einladung ausgesprochen wurde, betrachtete diese zurecht als Zeichen der persönlichen und der gesellschaftlichen Wertschätzung. Der überschaubare Kreis von Familien, die damals Kassels bessere Gesellschaft bildeten, nahm aufmerksam wahr, wer wen zum Konfirmandenkränzchen bat. Dort vertieften Bekannschaften sich zu Freundschaften, die ein Leben hielten, knüpfte sich Bänder der Sympathie, die Jahre später zur Ehe führten.
Für sie, als Konvertitin, gab es weder Konfirmandenkränzen noch Familienfeier. Trotzdem kreisten ihre Gedanken um die Frage, wen sie, wäre die Situation eine andere gewesen, in die elterliche Wohnung in der Spohrstraße eingeladen hätte, zu ihrem Kränzchen. Im Geiste ging sie die Namen der Jugendlichen durch, die von Herkommen oder Ansehen in Frage gekommen wären, und setzte sie auf eine imaginäre Liste. Von dieser strich sie dann jene, die sie nicht hätte einladen dürfen, da sie - das war eine Wendung der Eltern - „in der Frage wackelig oder eindeutig"
standen. Sie hätten abgelehnt, unter einem höflichen Vorwand vielleicht, oder wären einfach nicht erschieenen. Letzteres wäre ein Affront gewesen, den es zu vermeiden galt. Die Haltung „in der Frage“
gründete bei manchen auf Ressentiment, bei anderen auf Fanatismus und schied sie als unüberwindlicher Graben voneinander. Sie bedauerte das, denn die jungen Menschen waren – solange es nicht um „die Frage“
ging – nobel, gescheit, liebenswürdig, anziehend, von Gestalt oder Charakter.
© 2025
| Tous droits réservés | Christian Hartmeier